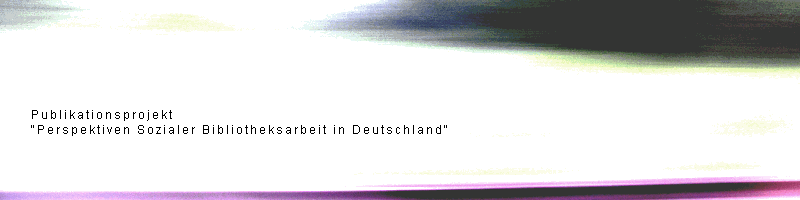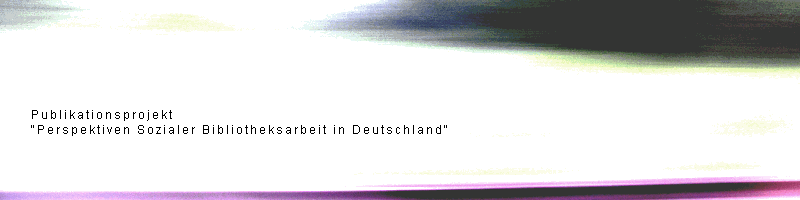Nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines drohenden gesellschaftsinternen
Digital Divide gewinnt das Thema „Soziale Bibliotheksarbeit“
an Relevanz. In einer Informations- bzw. Wissensgesellschaft, in
der Informationskompetenz – die neben der reinen Lese- und
Schreibkompetenz in verstärktem Maß die Fähigkeit
zum Auffinden bzw. Zugang, Bewerten und zielbezogenen Verarbeiten
von konkreten Informationen in bestimmten Anwendungskontexten umfasst
– grundlegend für erfolgreiches Agieren ist, droht die
Abkopplung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen akuter denn je.

Aber nicht nur bei sachlicher – und ausbildungs- bzw. berufsbezogener
– Anwendung von Informationen sondern auch bei der allgemeinen
Medienrezeption (zur Unterhaltung und/oder Kontemplation) wird angesichts
der Vielfalt der Mediengesellschaft die Entwicklung von Rezeptionsstrategien
zu einem entscheidenden Merkmal, um die Medienfülle zu verarbeiten.

Andererseits ist häufig, trotz des allerorten beklagten „Informationsüberfluss“
für die Zielgruppen sozialer Bibliotheksarbeit, der Zugang
zu Informationsmöglichkeiten nach wie vor ein Problem, was
durch Bibliotheksschließungen, Einstellen von Fahrbüchereien
etc. z.T. noch verschärft wird. Dies führt häufig
zu einer „Medienverarmung“ und damit zu einem weiteren
Ausschluss aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Geschehen.

Verschärft wird das Problem durch eine Beschneidung, bestenfalls
Stagnation, der Mittel für (öffentliche) Bibliotheken,
deren „Bildungsfunktion“ oftmals zugunsten einer „Unterhaltungsfunktion“
unterschätzt wird.

Auch zwingt die Budgetknappheit öffentlicher Haushalte Bibliotheken
zunehmend in eine Konkurrenz zu anderen kulturellen Einrichtungen,
woraus eine Fokussierung auf die Anwendung von „Marktgesetzen“
erfolgt. Benchmarking, Evaluationsverfahren und fragwürdige
Zielvereinbarungen bezüglich der quantitativen Bibliotheksnutzung
sind Indikatoren dieser Entwicklung, bei der die Nischen für
besondere, häufig als problematisch geltende, Nutzergruppen
schwinden.

Dass die „Soziale Bibliotheksarbeit“ momentan in Deutschland
selbst innerhalb der Bibliothekslandschaft bestenfalls als Randthema
wahrgenommen wird, hat augenscheinlich zwei miteinander zusammenhängende
Ursachen:

1. Sie erhält in der ohnehin angespannten Situation im deutschen
Bibliothekswesen als Vertreter von

 prinzipiell
eher lobbyschwachen Interessengruppen wenig Gehör.
prinzipiell
eher lobbyschwachen Interessengruppen wenig Gehör.
2. Es ist bislang nicht gelungen, die stattfindenden Aktivitäten
in größerem Stil zu bündeln und in die
 (Fach-)Öffentlichkeit
zu tragen.
(Fach-)Öffentlichkeit
zu tragen.

Der geplante Band soll den aktuellen Stand der „Sozialen Bibliotheksarbeit“
in Deutschland abbilden und Perspektiven aufzeigen.

Dabei geht es um:

- die konkrete Formulierung und Differenzierung von Themen- und
Problemfeldern
- die theoretische Auseinandersetzung von Potentialen, Trends und
Entwicklungsmöglichkeiten
- die Vorstellung konkreter Ideen und Projekte.

Folgende Bibliothekstypen und Bibliotheksangebote sollen berücksichtigt
werden:

- Einrichtungen und Angebote für sehgeschädigte/blinde
Personen
- Angebote für einkommensschwache/erwerbslose Personen
- Angebote für bildungsschwache Personen inklusive Analphabeten
und jugendliche Problemgruppen
- Einrichtungen und Angebote in Justizvollzugsanstalten
- Patientenbüchereien
- Einrichtungen und Angebote für Senioren inklusive Seniorenbibliotheken
z.B. in Pflegeeinrichtungen
- Einrichtungen und Angebote für Immigranten, Asylbewerber
und in Deutschland lebende Ausländer
- Werksbibliotheken
- alternative soziale Angebote von öffentlichen Bibliotheken

Der Band wird beim Verlag BibSpider – Info-Networking
for Libraries erscheinen.

Interessierte Autoren werden gebeten, sich mit einem kurzen Exposé
bzw. Abstract ihres Beitrages an die unten angegebene Adresse zu
wenden.

Der Redaktionsschluss ist für den 1. November 2005 geplant.